Aktuelle Themen aus Gesellschaft, Politik und Recht
Empört euch! – Wie wir in der Dauerkrise abstumpfen und was dagegen hilft
Heutzutage stolpern wir gefühlt ständig von einer Krise in die nächste. Finanzkrise, Klimakrise, Pandemie, Kriege – ehrlich, das hört einfach nicht auf. Stéphane Hessel, ein französischer Widerstandskämpfer und UN-Diplomat, hat uns schon 2010 mit seinem Essay „Empört Euch!“ zum Handeln aufgerufen.
Er wollte, dass wir gegen Ungerechtigkeiten aufstehen und uns eben nicht einfach mit dem Status quo abfinden.

Aber je länger wir im Krisenmodus leben, desto mehr verlieren wir unsere Fähigkeit, uns zu empören – wir stumpfen ab, werden müde, fühlen uns irgendwie machtlos. Was uns früher schockiert hat, nehmen wir heute als neue Normalität hin.
Die ständige Flut globaler Probleme bringt uns oft nicht zum Handeln, sondern eher zur Resignation.
Gerade jetzt, wo laut Hessel der Finanzkapitalismus unsere Werte bedroht und die Umwelt weiter leidet, müssen wir unsere Fähigkeit zur Empörung irgendwie behalten. Aber wie soll das gehen, ohne dass wir an dieser Dauerkrise zerbrechen?
Wie finden wir den Mittelweg zwischen totaler Abstumpfung und Überreizung?
Die Botschaft von „Empört euch!“: Aufruf zur Wachsamkeit

Stéphane Hessels Streitschrift „Empört euch!“ ist eigentlich mehr als nur ein Bestseller. Sie klingt wie ein leidenschaftlicher Appell, gegen Gleichgültigkeit und Selbstzufriedenheit zu kämpfen und den kritischen Geist wachzuhalten.
Entstehung und historischer Kontext der Streitschrift
Mit 93 Jahren schrieb Hessel „Empört euch!“ im Jahr 2010 als Antwort auf immer mehr soziale Ungerechtigkeiten und politische Missstände. Erst erschien die Streitschrift in Frankreich, dann wurde sie schnell ein internationales Phänomen.
Bis Februar 2011 gingen über eine Million Exemplare über den Ladentisch.
Hessel war keine gewöhnliche Stimme. 1917 in Berlin geboren, wurde er später französischer Staatsbürger, kämpfte im Widerstand gegen die Nazis und überlebte das KZ Buchenwald.
Nach dem Krieg arbeitete er als UN-Diplomat und unterzeichnete 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte mit.
Seine Biografie gibt dem Text echtes Gewicht. Als jemand, der die dunkelsten Stunden Europas erlebt und am Wiederaufbau mitgewirkt hat, spricht er mit der Autorität eines Mannes, der den Wert von Widerstand am eigenen Leib kennt.
Zentrale Thesen und Anliegen von Stéphane Hessel
Hessels Botschaft ist klar: Empörung ist der erste Schritt zu Engagement. Er ruft zu einem „Aufstand der Friedfertigen“ gegen ganz konkrete Missstände auf:
- Die unkontrollierte Macht der Finanzmärkte
- Die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich
- Die ökologische Krise
- Verletzungen der Menschenrechte
- Die Lage der Palästinenser
Mit dem fast biblischen Satz „Suchet, und ihr werdet finden!“ ermutigt Hessel jeden, sein eigenes Empörungs-Motiv zu suchen. Er meint: „Das ist kostbar. Wenn man sich über etwas empört, wie mich der Naziwahn empört hat, wird man aktiv, stark und engagiert.“
Sein Appell richtet sich an alle Generationen, aber besonders an junge Menschen. Er will keine blinde Wut, sondern konstruktiven, gewaltfreien Widerstand.
Die Rolle der Résistance im moralischen Appell
Hessels Streitschrift durchzieht der Geist der Résistance. Er bezieht sich direkt auf das Programm des Nationalen Widerstandsrats vom 15. März 1944, das später die Basis des französischen Sozialstaats wurde.
Diese historische Anbindung ist kein Zufall. Hessel sieht in den Prinzipien der Résistance – Solidarität, Gemeinwohl und soziale Sicherheit – Werte, zu denen die Politik zurückkehren sollte.
Er reagiert damit auch auf die symbolische Vereinnahmung der Résistance-Erinnerung durch Politiker wie Nicolas Sarkozy.
Für Hessel steht die Résistance nicht nur für Widerstand gegen Besatzung, sondern für einen grundsätzlichen moralischen Kompass. Wenn Menschen damals gegen die Nazi-Barbarei kämpften, dann müssen wir heute gegen den Abbau sozialer Errungenschaften, Gleichgültigkeit und Zynismus aktiv werden.
Hessels Rückgriff auf die Résistance gibt seinem Aufruf historische Tiefe und eine gewisse Dringlichkeit.
Abstumpfung in der Dauerkrise: Ursachen und Symptome
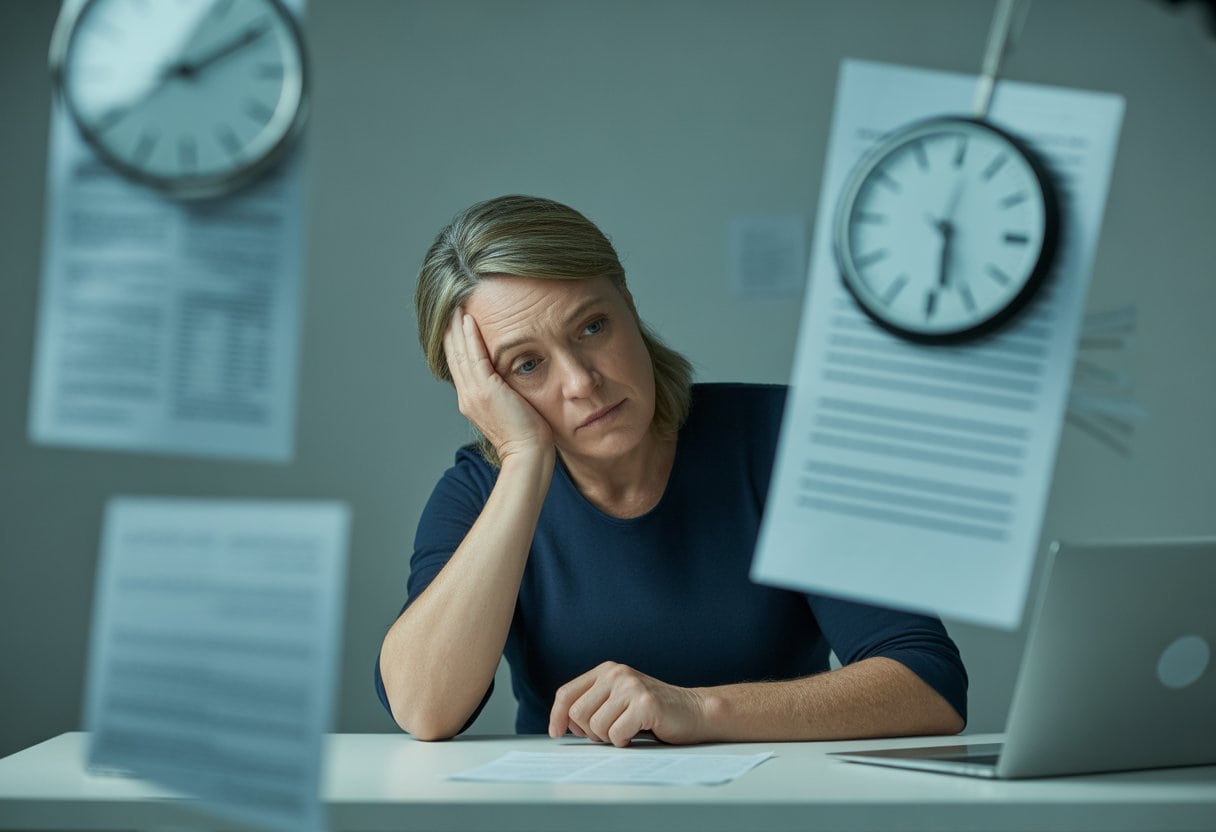
Gerade in einer Zeit voller Krisen stumpfen viele Menschen emotional ab – ein Schutzmechanismus, der fast schon normal wirkt. Das ständige Gefühl von Krise ist heute überall, und das bleibt nicht ohne Folgen für unsere Psyche.
Gesellschaftliche Herausforderungen und Dauerkrisen
Unsere Gesellschaft steckt in dem, was Experten „Polykrise“ nennen. Klimawandel, Pandemie, Ukraine-Krieg und wirtschaftliche Unsicherheit laufen gleichzeitig ab.
Diese Gleichzeitigkeit fühlt sich bedrohlicher an als frühere Krisen.
Wir spüren die Auswirkungen direkter als früher. Schulschließungen, Einkommensverluste, steigende Energiepreise – das alles trifft uns unmittelbar.
Krisenforscher Stefan Kroll sagt, eine Krise hat drei Merkmale:
- Es gibt eine neue Bedrohung, die zum Handeln zwingt.
- Wir wissen nicht genau, wie wir damit umgehen sollen.
- Die Krise wird von allen als solche wahrgenommen.
Mechanismen der Gleichgültigkeit und deren Auswirkungen
Wenn wir ständig mit schlechten Nachrichten bombardiert werden, schaltet unser Gehirn irgendwann auf Schutz. Emotionale Abstumpfung hilft uns, nicht komplett überfordert zu sein.
Dafür gibt es viele Gründe. Die Nachrichtenflut ist einer, aber auch psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Nebenwirkungen von Medikamenten spielen eine Rolle.
Diese Abstumpfung hat Folgen. So wie Bewegungsmangel dem Körper schadet, schadet emotionale Unbeweglichkeit unserer Psyche.
Studien zeigen schon: Immer mehr Menschen meiden Nachrichten, um sich zu schützen. Dieser Rückzug entlastet vielleicht kurz, verhindert aber langfristig Engagement.
Der Verlust politischer Wachsamkeit
„Empört euch!“ – dieser Appell von Hessel wirkt in Zeiten der Dauerkrise irgendwie schwächer. Die Dauerkrise nimmt uns paradoxerweise das politische Engagement.
Manche Menschen resignieren, andere werden wütend. Noch schlimmer: Diese Wut kann in politische Radikalisierung umschlagen.
Vor allem bei jüngeren Generationen fällt das auf. Studien zeigen, dass die „Dauerkrisen-Generation“ mit psychischen Belastungen kämpft.
Die ständige Bedrohung macht sie oft machtlos.
Experten sagen: Verdrängung kostet mehr Kraft als die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen. Für eine gesunde politische Kultur müssen wir die Balance finden – nicht alles an uns heranlassen, aber auch nicht komplett abschalten.
Der Wert von Empörung und Widerstand heute
Empörung ist mehr als ein Gefühl – sie kann echte Veränderungen anstoßen. Stéphane Hessels „Empört euch!“ erinnert uns daran, dass Widerstand gegen Ungerechtigkeit zur Demokratie dazugehört.
Aktuelle Formen von Résistance und Engagement
Heute sieht Widerstand ganz unterschiedlich aus. Bewegungen wie Fridays for Future oder die Proteste in Spanien 2011 berufen sich direkt auf Hessels Gedanken.
Sie kämpfen nicht mehr nur gegen einen sichtbaren Feind, sondern gegen komplexe Systeme wie Finanzkapitalismus oder Klimakrise.
Digitaler Aktivismus ergänzt klassische Protestformen. Über soziale Medien mobilisieren Menschen schnell und machen auf Missstände aufmerksam.
Was erfolgreiche Bewegungen gemeinsam haben? Sie setzen sich klare Ziele und bleiben dran. Sie erreichen viele Leute und machen Probleme sichtbar.
Friedlicher Protest und ziviler Ungehorsam
Hessel legt Wert auf gewaltlosen Widerstand. Diese Form des Protests hat sich als besonders wirksam erwiesen, um gesellschaftlichen Wandel anzustoßen.
Ziviler Ungehorsam – also bewusst Regeln brechen, um auf Unrecht hinzuweisen – ist ein starkes Mittel. Es braucht Mut und die Bereitschaft, Konsequenzen zu tragen.
Formen des friedlichen Widerstands:
- Demonstrationen und Kundgebungen
- Boykotte und bewusster Konsum
- Symbolische Aktionen und kreative Proteste
- Blockaden und Besetzungen
Entscheidend ist, die Öffentlichkeit zu erreichen, ohne andere zu vergraulen. Friedlicher Protest kann Brücken bauen, wo Aggression nur Gräben schafft.
Individuelle Verantwortung in der Demokratie
Hessels Appell richtet sich direkt an jeden von uns. Er erinnert uns daran, dass Demokratie nur funktioniert, wenn wir aktiv mitmachen.
Du bist selbst dafür verantwortlich, nicht einfach gleichgültig zu werden. Hessel hat es ziemlich deutlich gesagt: „Das Schlimmste, was man sich und der Welt antun kann,“ ist, wenn wir uns nicht mehr für politische Verhältnisse interessieren.
Deine Stimme zählt – nicht bloß bei Wahlen, sondern auch im Alltag. Frag dich ruhig öfter, ob die Infos, die du bekommst, wirklich stimmen, und steh für das ein, was dir wichtig ist.
Demokratische Teilhabe beginnt oft im Kleinen: in deiner Nachbarschaft, am Arbeitsplatz oder in der Schule. Gerade dort kannst du direkt etwas bewirken und Veränderungen anstoßen.
„Empört euch!“ als gesamtgesellschaftlicher Weckruf
Hessels Manifest erschien 2010 und schlug ein wie ein Blitz. Millionen Menschen kauften das Buch, und es hat weltweit viele inspiriert.
Seine Botschaft klingt einfach, fast schon brutal ehrlich: Empörung ist der erste Schritt, wenn wir etwas verändern wollen.
Damals war Hessel 93 Jahre alt. Er erinnerte an die Werte der französischen Résistance und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte.
Er hatte selbst an deren Ausarbeitung mitgewirkt. Für ihn bedrohten Finanzkapitalismus und wachsende Ungleichheit diese Werte immer mehr.
Am Ende ruft er: „Neues schaffen heißt, Widerstand leisten. Widerstand leisten heißt, Neues schaffen.“ Das klingt heute noch genauso relevant, oder?
„Empört euch!“ schüttelt uns wach. Es fordert uns auf, nicht abzustumpfen und wieder sensibel für Ungerechtigkeiten zu werden.
Es macht klar: Eine lebendige Demokratie lebt vom Engagement der Bürger.



